




Am 6. März 1953 wurde Stalins Leichnam in der Säulenhalle im Zentrum Moskaus im Haus der Gewerkschaften aufgebahrt. Hunderttausende weinten voller Anteilnahme. Doch es gab auch Ausnahmen. Foto: AP
In diesen Tagen jährt sich der Tod von Josef Stalin zum 60. Male. Bis zu seinem Tode war er über Jahrzehnte mit einer überragenden Machtfülle ausgestattet - seit 1922 Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU), und ab 1941 Regierungschef der UdSSR sowie Oberster Befehlshaber der Roten Armee. Am 6. März 1953 wurde sein Leichnam in der Säulenhalle im Zentrum Moskaus im Haus der Gewerkschaften aufgebahrt. Hunderttausende weinten voller Anteilnahme und schluchzten vor Schmerz. Alle wollten sich von Stalin verabschieden und ihm die letzte Ehre erweisen. Viele waren organisiert und kamen in Kolonnen anmarschiert.
Doch es gab auch Ausnahmen. Augenzeugen berichten nun, wie sie die ersten Tage des März 1953 erlebt hatten. Einigen gefielen die von Partei und Staat angeordneten Beileidsbekundungen nicht, anderen gelang es, sich der Tragödie zu entziehen, die sich am 9. März 1953 ereignete, dem ersten Tag der Abschiedszeremonie. In Mitten des Tumultes und Gedränges starben einige Dutzend, vielleicht sogar hundert Menschen - genauere Angaben fehlen bis heute.
Dalila Owanesowa, 1953 Schülerin
 |
Dalila Owanesowa. Foto aus dem persönlichem Archiv |
"An Stalins Todestag, dem 5. März 1953, hat man uns in der Schule versammelt. Wir mussten im Korridor zum Ehrenappell antreten. Es spielte Trauermusik. Ich erinnere mich an die Ehrenwache der Pioniere und Komsomolzen neben der Büste Stalins: Sie hatten Haltung angenommen und salutierten. Alle schluchzten, Schüler wie Lehrer. Nur ich konnte nicht weinen. Ich war völlig verwirrt. Der Unterricht fiel aus.
Als ich nach Hause kam, machte sich eine gewisse verhaltene Freude in mir breit. Ich wusste gar nicht so recht, warum. Es war nicht der schulfreie Tag, auch in den Augen meiner Mutter sah ich Verzückung, Glanz und Freude. Auch ihr Gang und ihre Gestik wirkten irgendwie befreit und munter. Später konnte ich das alles besser verstehen: Meine Großmutter war in Wirklichkeit nämlich meine "Mama", weil sie mich und meinen Bruder großzog. Ihr richtiger Sohn, mein Onkel Jurij Dombrowskij, war Schriftsteller und wurde verfolgt. Damals saß er im Lager.
Aber "Mama" hatte mir diese Zusammenhänge nie erklärt. Was konnte man in diesen Zeiten den Kindern schon anvertrauen? Ich hatte da eine Schulfreundin, Walja Neskutschajewa, ihre Eltern hatten ihr den Umgang mit mir strengstens verboten. „Mama und Papa erlauben mir nicht, dass ich mit dir befreundet bin, weil deine Familie unzuverlässig ist." An ihre Worte kann ich mich noch gut erinnern. Anfangs hatten sie mich nur erstaunt, verstanden habe ich sie lange nicht."
Walentina Schischkina, 1953 Schülerin
 |
| Walentina Schischkina, Foto aus dem persönlichem Archiv |
Wir waren gerade zu Hause, als wir im Radio von Stalins Tod hörten. Meine Mutter und meine ältere Schwester Tamara heulten sofort los. Ich weinte auch. Unser oberster Partei- und Staatsführer, den wir mehr liebten als Vater und Mutter, unser Gott, war gestorben! Am nächsten Tag gingen wir in die Schule. Dort fand ein erhabener Trauerappell statt, bei dem wieder alle schluchzten. Tamara wollte unbedingt mit ihrer Freundin zum Begräbnis, obwohl meine Mutter kategorisch dagegen war. Ich erinnere mich, wie sie sich demonstrativ in die Tür stellte.
Tamara ging trotzdem. Von der Leningrader Chaussee, die damals noch am Stadtrand lag, gingen sie die sechs, sieben Kilometer bis ins Zentrum zum Puschkin-Platz zu Fuß, weil keine Straßenbahnen fuhren. Auf dem Puschkin-Platz empfing sie ein riesiges Gedränge, das kein Ende nehmen wollte. Immer mehr Leute rückten von hinten nach, so dass sie richtig Angst bekamen. Zum Glück krochen sie unter Lkws durch und kamen so wieder auf eine der weniger belebten Gassen. Die Soldaten ließen die vollkommen verstörten Mädchen passieren. Schließlich gelangte Tamara wieder zur Leningrader Chaussee und nach Hause zurück. Stalin hatte sie nicht gesehen.
Felix Kwascha, 1953 Student am Maschinenbauinstitut
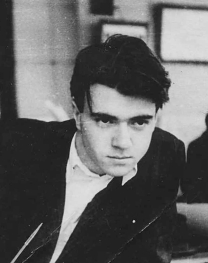 |
Felix Kwascha, Foto aus dem persönlichem Archiv |
1953 studierte ich im zweiten Studienjahr. Ich wohnte in Scheremetjewo im Studentenwohnheim. Ich musste mir das Zimmer mit 20 anderen Kommilitonen teilen. Es ging damals zu wie in einer Kaserne. Am Abend erfuhren wir durchs Radio vom Tod Stalins. Alle heulten los: Wir waren erschüttert, empfanden das Ereignis als Ende der Welt. Am nächsten Tag gegen Mittag sollten wir in der Säulenhalle des Hauses der Gewerkschaften von Stalin Abschied nehmen.
Wir mussten eine Kolonne formieren, bestimmt 500 Menschen oder mehr. Man befahl uns, nicht auseinanderzulaufen, und kündigte an, dass man das streng kontrollieren werde. So kam es dann auch. Bevor wir abmarschierten, standen wir zwei, drei Stunden herum. Dann ging's los. Anfangs war das noch harmlos: Wir gingen, stoppten, gingen wieder ein Stück. Während der Marschpausen rief man immer wieder unsere Namen auf, um sich zu vergewissern, ob wir noch in der Kolonne waren.
Gegen Abend erreichten wir das Zentrum und zwängten uns ins allgemeine Gedränge auf der Trubnaja-Straße. Ich sah eine riesige Menschenansammlung, Tausende, Zehntausende von Leuten! Von diesem Moment an war von unserer Kolonne auch schon nichts mehr übrig. Wir wurden in der Masse auseinandergerissen. Anfangs sah ich noch fünf, sechs bekannte Gesichter, dann aber empfand ich die anderen nur noch als einzigen Brei aus fremden Menschen, die sich wie Tiere aufführten. Wir waren eingepfercht zwischen zwei Reihen Lastwagen, die die Straße säumten. Auf dem Bürgersteig dahinter bildeten Soldaten einen Kordon. Alle Seitenstraßen, Häuser und Höfe waren verrammelt, selbst jeder Hauseingang.
Die Nacht war schrecklich. Wir standen die ganze Zeit dicht an dicht gedrängt, ohne uns auch nur ein Stück vorwärtszubewegen. Wir hatten nichts zu trinken oder zu essen. Man konnte nicht aufs Klo. Am schlimmsten war es, wenn man gegen die Lkw gedrückt wurde. Ich hatte panische Angst, dass ich dort niemals mehr rauskommen würde. Gegen Morgen - nur noch ein paar hundert Meter entfernt vom Trubnaja-Platz - tauchen irgendwelche Jungs auf; 16, 17 Jahre alt. Sie machten keinen Hehl daraus, dass sie von der Straße verschwinden wollten, am besten über die Dächer.
Sie fanden doch tatsächlich einen schlecht verschlossenen Hauseingang und zerrten mich mit hinein. Auf diese Weise haben sie mir möglicherweise das Leben gerettet. Vom Eingang gelangten wir in einen Durchgangshof, dann in einen zweiten und noch einen. Hier konnten wir aufs Dach klettern. Ich sprang dann irgendwo herunter und fand mich in einer der weniger belebten Parallelstraßen wieder, dem Blumen-Boulevard. Ich war völlig fertig, aber am Leben. Später erfuhr ich, dass es tatsächlich Tote gegeben hatte.
Alle Rechte vorbehalten. Rossijskaja Gaseta, Moskau, Russland
Abonnieren Sie
unseren kostenlosen Newsletter!
Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!