Postsowjetische Länder: Die Krise mit der Identität
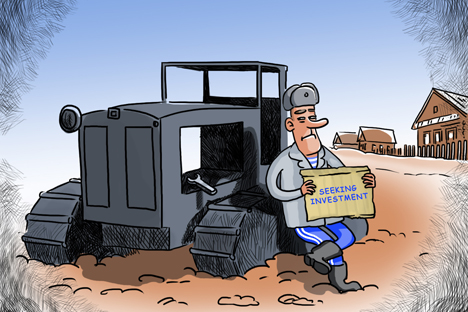
Bild: Konstantin Maler
Der Vierer-Gipfel in Genf endete mit einer Vereinbarung über eine schrittweise Deeskalation des Ukraine-Konflikts. Erstmals seit Beginn der Ereignisse in der Ukraine zeichneten sich Konturen einer gemeinsamen Basis alle Konfliktseiten heraus. Es besteht die Aussicht, aus der politischen Sackgasse, in der die Ukraine sich heute befindet, herauszukommen.
Zwar verdient die erkennbare Bereitschaft der Verhandlungspartner, von Maximalforderungen abzurücken und nach Kompromissen zu suchen, Anerkennung, doch die Deeskalation selbst ist nur ein taktisches Instrument. Sie wird weder die Krise des ukrainischen national-staatlichen Projekts und die Probleme der ukrainischen Identität lösen noch neue Spielregeln in der internationalen Arena etablieren.
UdSSR-Nachfolgestaaten in der Krise
Die Lage in der Ukraine war in den vergangenen Monaten das Top-Thema der Nachrichtenagenturen und beherrschte weltweit die Schlagzeilen. Selbst die Konflikte im Nahen Osten traten in den Hintergrund. Die beharrliche mediale Aufmerksamkeit hat einen triftigen Hintergrund.
Seit den Balkankriegen war die Sicherheit in Europa nicht mehr solchen harten Prüfungen ausgesetzt. Die Ukraine ist flächenmäßig das zweitgrößte Land des geografischen Europas. Bei der Einwohnerzahl belegt sie Platz fünf. Zurzeit herrschen in der Ukraine chaotische Zustände und die ukrainische Regierung wirkt hilflos und ohne Hoffnung. Welche Probleme liegen der massiven Zuspitzung der Krise in der Ukraine zugrunde?
Die Ukraine konnte in den Jahren ihrer Unabhängigkeit keine gesellschaftliche und politische Identität herausbilden. Das verschärft die Krise. Neben zahlreichen kleineren Volksgruppen, wie zum Beispiel den etwa 200 000 Ungarn, leben in der Ukraine drei große Gemeinschaften: die ukrainisch sprechenden Ukrainer, die russischsprachigen Ukrainer und die Russen. Alle haben sehr unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft des ukrainischen Staates und ihrer Rolle darin.
Die territoriale Integrität sicherstellen
Die jüngsten Ereignisse in der Ukraine zeigen zudem einen Trend: Die Nachfolgestaaten der Sowjetunion beginnen, auseinanderzufallen. Die UdSSR als Staat und Völkerrechtssubjekt existiert freilich schon seit über zwanzig Jahren nicht mehr. Der Zerfall des einstigen Imperiums darf
jedoch nicht nur als formal-juristischer Akt verstanden werden. Die Unterzeichnung der Belowescher Vereinbarungen besiegelte das Ende der UdSSR, konnte aber keine neuen staatlichen und gesellschaftlichen Identitäten begründen. Es reichte nicht, sich Ukraine, Moldawien oder Georgien zu nennen. Praktisch alle Republiken der ehemaligen UdSSR, die sich als neue unabhängige Staaten formierten, sahen sich vor mehr oder weniger komplexe Probleme gestellt.
Die UdSSR stellte die „territoriale Integrität" der Ukraine, Aserbaidschans, Georgiens und Moldawiens durch einen repressiven Apparat und eine machtvolle Propaganda sicher. Nach 1991 jedoch standen die in die Unabhängigkeit entlassenen Staaten vor der Aufgabe, nach Wegen einer Heranbildung neuer Staatsbürger zu suchen.
Die Ukraine entschied sich nicht für eine regionale Diversifikation, mit der die Interessen der verschiedenen Teile des Landes hätten berücksichtigt werden können. Solange die ukrainische Regierung eine Interessenbalance der verschiedenen Machteliten sicherstellte, war die „nationale Einheit" gewahrt. Als der Maidan den gewohnten Status quo ins Wanken brachte, verstärkten sich die zentrifugalen Tendenzen.
Putin als großer Imperator?
Die Äußerungen des russischen Präsidenten Wladimir Putin über die Beteiligung des russischen Militärs an den jüngsten Kämpfen um Selbstbestimmung der Krim deuteten viele Experten und Journalisten als Beleg für die „imperialen Bestrebungen" Moskaus. Dabei vergessen sie,
dass Russland 2008 kurz nach dem Fünf-Tage-Krieg im Kaukasus den „großen Vertrag" mit der Ukraine verlängerte, der auf einer Anerkennung ihrer Grenzen beruhte.
Russland zeigte sich auch in den Jahren 1994 bis 1995, als auf der Krim eine prorussische Bewegung Auftrieb erhielt, bestrebt, die Belowescher Prinzipien der wechselseitigen Anerkennung von Republikgrenzen nicht aufs Spiel zu setzen – allein deshalb, weil in Kiew eine zwar unbequeme, aber doch zu einer politischen Führung des gesamten Landes fähige Regierung an der Macht war.
Für eine Einmischung von außen müssen innere Voraussetzungen erfüllt sein. Eine prorussische Agitation, wie sie der Westen Russland vorwirft, wäre ansonsten folgenlos geblieben. Auch ohne die „grünen Männchen" gab es für die zentrifugalen Tendenzen auf der Krim, im Süden und im Osten der Ukraine fundamentale Gründe.
Und hier greift die zweite prinzipiell wichtige, angesichts der gegenwärtigen ukrainischen Krise aber auch äußerst brisante These. Die neuen unabhängigen Staaten Eurasiens können ihre Außenpolitik nicht in Konfrontation mit Russland gestalten. Wesentliche Teile der Bevölkerung dieser Länder sind nicht bereit, ihre Integration in den Westen mit dem Preis einer Abwendung von Russland zu bezahlen.
Kein Entweder-Oder-Zwang
Das betrifft nicht nur die russischen und russischsprachigen Ukrainer. Selbst nach der Veränderung des Status der Krim sind übrigens etwa 40 Prozent der Ukrainer, in einigen Regionen sogar noch viel mehr, gegen einen Nato-Beitritt. Auch die Gagausen und die Bewohner Transnistriens in Moldawien suchen keine Konfrontation mit Moskau. Ebenfalls lässt sich das über die Abchasen und Osseten sagen, die vom überwiegenden Teil der
Weltgemeinschaft als Bürger Georgiens betrachtet werden.
Es stellt sich also die begründete Frage: Kann man die neuen unabhängigen Länder überhaupt vor eine radikale Entweder-Oder-Entscheidung stellen, wie das im Vorfeld der geplanten Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Union durch die Ukraine geschehen ist?
In den postsowjetischen Staaten hat eine Integration in die Strukturen der EU und Nato zweifellos viele Fürsprecher. Das Gleiche gilt aber auch für eine Kooperation und sogar für Bündnisse mit Russland. Wie lässt sich dieses Dilemma lösen?
Es zeichnen sich hier zwei Perspektiven ab. Russland und der Westen müssten entweder in eine neue Spirale der Konkurrenz um Vormachtstellung in diesem Teil der Welt eintreten. Die Länder der ehemaligen UdSSR würden sich dabei in Schauplätze für „Stellvertreterkriege" verwandeln. Die Alternative wäre ein effektiver Dialog, in dem die besonderen Interessen Russlands berücksichtigt und als legitim betrachtet würden. Eine ideologisierte Lesart der Interessen Moskaus als „Resowjetisierung" auszulegen, ist nicht angemessen.
Sergej Markedonow lehrt an der Fakultät für ausländische Regionalforschung und Außenpolitik der Russischen Staatlichen Universität für Geisteswissenschaften.
Dieser Beitrag erschien zuerst bei RIA Novosti.
Alle Rechte vorbehalten. Rossijskaja Gaseta, Moskau, Russland
Abonnieren Sie
unseren kostenlosen Newsletter!
Erhalten Sie die besten Geschichten der Woche direkt in Ihren Posteingang!


